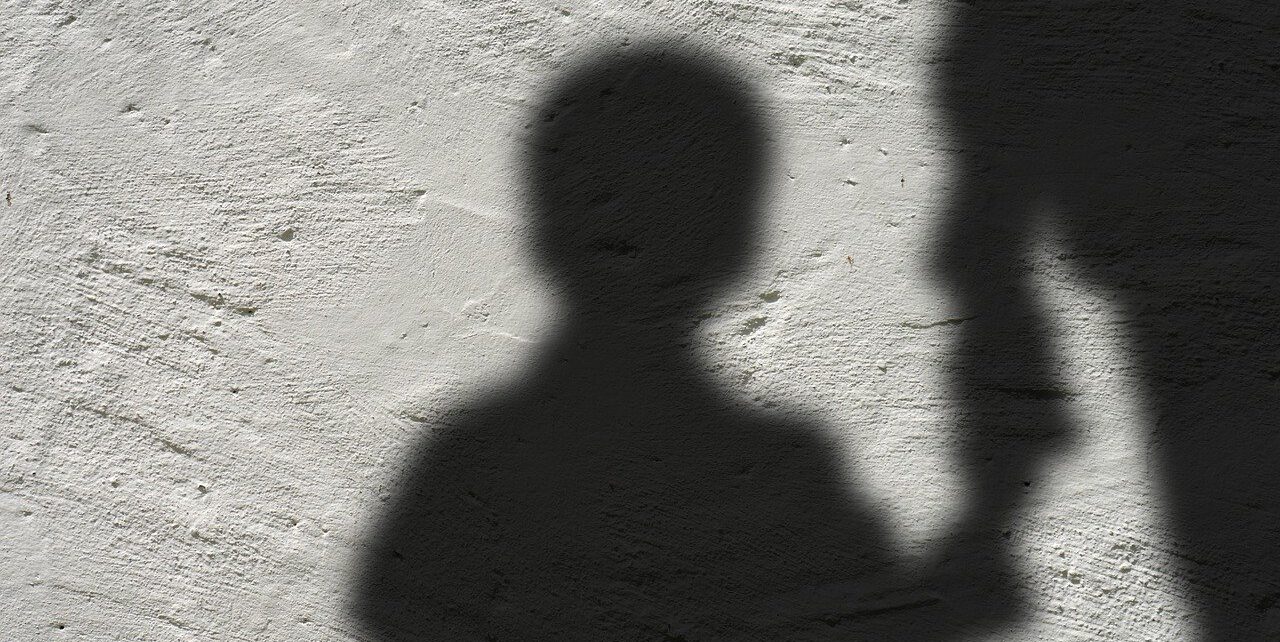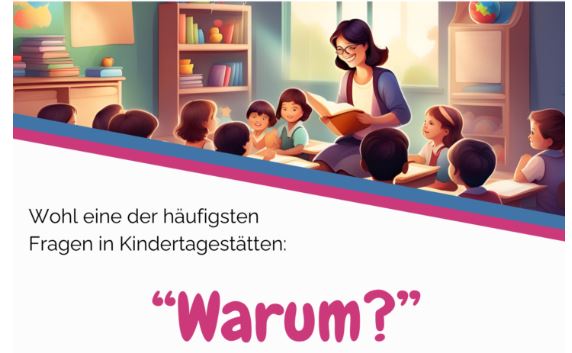Unter diesem Titel hat der Kinderschutzbund Kreisverband Landau – Südliche Weinstraße (DKSB LD-SÜW), besser bekannt als der „Blaue Elefant“, gemeinsam mit dem Jugendamt SÜW einen neuen Leitfaden herausgegeben, der eine sehr große Hilfe beim Verdacht auf Kindeswohlgefährdung darstellt.
„Nicht wegschauen – Vorgehensweise im Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“
Der Leitfaden richtet sich in erster Linie an betreuende Personen (z.B. in Kita, Schule oder Sportverein), die eine Kindeswohlgefährdung im Elternhaus vermuten. Er gibt einen Überblick über die Abläufe im Falle einer Kindeswohlgefährdung und beinhaltet auch alle erforderlichen Vorlagen zur Dokumentation und Meldung der Vorfälle.
Er setzt jedoch bereits viel früher an, nämlich bei der Einschätzung, ob tatsächlich ein begründeter Verdacht bestehen könnte oder nicht. Dabei sind beispielsweise typische Verletzungsmuster aufgeführt, die auf Gewalt hindeuten.
Aber auch für Eltern lohnt sich ein Blick in den Leitfaden, wenn sie eine Gefährdungssituation für Kinder vermuten. Für selbst betroffene Eltern schafft der Leitfaden Transparenz hinsichtlich der dann erfolgenden Schritte und erleichtert es, Hilfsangebote anzunehmen.
Verdacht auf Kindeswohlgefährdung in einer Einrichtung
Als Eltern wünschen wir uns einen liebevollen und bedürfnisorientierten Umgang mit unseren Kindern. Betreuende Institutionen wie Kita und Schule geben ihr bestes, diesem Wunsch (auch aus Eigenmotivation) nachzukommen. Doch leider gibt es auch im Bereich der professionellen Kinderbetreuung Situationen und Verhaltensweisen, die nicht kindegerecht sind. Diese „beginnen“ bei „Kleinigkeiten“ wie verletzendem Verhalten oder Adultismus und enden leider auch nicht bei regelmäßigen Gefährdungslagen in Verbindung mit Gewalt oder sexuellem Missbrauch. Zwischen unbewusst herbeigeführten Grenzverletzungen und absichtlichen Verhaltensweisen mit Straftatbestand kommen Kindeswohlgefährdungen in allen unterschiedlichen Ausprägungen täglich vor. Oftmals sind diese nicht offensichtlich oder überhaupt als solche zu erkennen.
Kindeswohlgefährdung geschieht häufig auch unbewusst
Daher ist es wichtig hinzuschauen und offen über verletzendes Verhalten zu sprechen. Was ist verletzendes Verhalten und wie erkennt man es? Wie kann man als Fachkraft vermeiden, ungewollt in diese Muster zu fallen? Was können Eltern tun, wenn sie befürchten, ihrem Kind wird nicht mit der angemessenen Feinfühligkeit begegnet?
„Nein, Paul kommt zum Ausflug nicht mit, er konnte sich gestern nicht benehmen.“
Zum Thema Verletzendes Verhalten veranstaltet der Landeselternausschuss RLP in Kooperation mit dem Kita-Fachkräfteverband RLP eine Online-Infoveranstaltung, um über das Thema aufzuklären und dafür zu sensibilisieren. Referentin wird Fr. Dr. Remsberger-Kehm sein, Autorin der gleichnamigen, in der Fachwelt bekannten und anerkannten Studie.
Wie erkenne ich eine Kindeswohlgefährdung und was kann ich tun?
Eltern stehen an dieser Stelle vor dem selben Problem wie die Fachkräfte: Kann das sein? Es gibt keine konkreten Hinweise, aber ich habe ein komisches Bauchgefühl? Soll ich was sagen oder beschuldige ich jemanden zu Unrecht?
Auch für diesen Fall gibt es einige hilfreiche Unterlagen und Informationen im Internet. Beispielsweise die Arbeitshilfe Gefährdung des Kindeswohls innerhalb von Institutionen des Paritätischen Gesamtverbandes, welche auch Hinweise speziell für Elternvertreter enthält. Auch die GEW hat eine hilfreiche Broschüre veröffentlicht, die sich mit dem Thema beschäftigt:
Neben diesen Broschüren gibt es viele weitere Informationsquellen, welche am Ende dieses Beitrags als Link zu finden sind.
Zuständig für Verdachtsfälle der Kindeswohlgefährdungen in Kitas ist das Landesjugendamt. Dieses kann auch in beratender Funktion kontaktiert werden, ohne dass man direkt eine Meldung absetzen oder den konkreten Fall nennen muss.
Kinder haben ein Recht auf Achtung, Vertrauen und Zuneigung. Die Aufgabe von uns Erwachsenen ist, für diese Rechte einzustehen. Daher gilt in allen Fällen, egal durch wen ein Kind in seinen Rechten beschnitten wird: Nicht wegschauen!
Weiterführende Links
Adultismus – die erste erlebte Form der Diskriminierung? – element-i